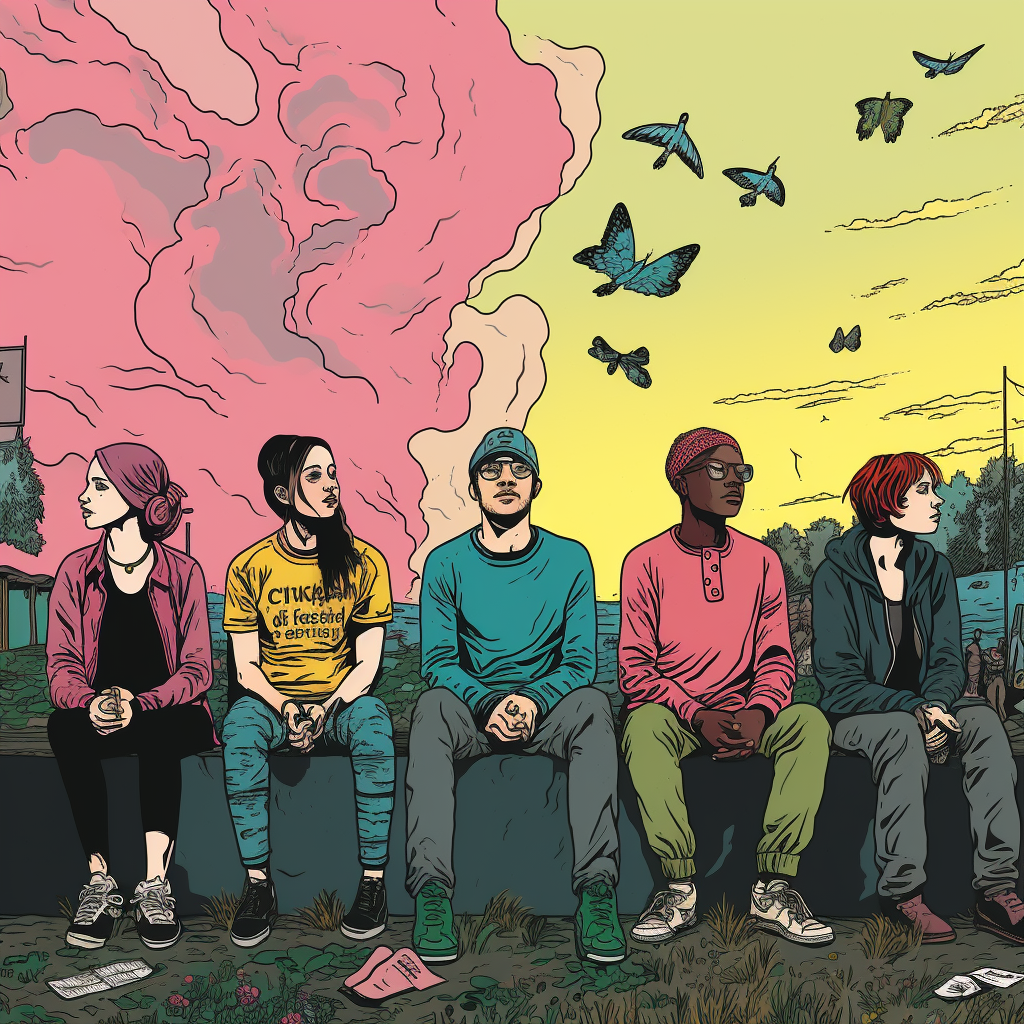Die selbstreflexive Wende
In den letzten Jahren beobachte ich eine Entwicklung im aktivistischen Umfeld, die mir interessant und bedeutsam erscheint. Eine Reihe von Aktivistinnen reflektieren selbstkritisch die Prämissen ihrer eigenen Handlungen. Sie fragen sich, inwiefern ihre herkömmlichen Strategien ineffektiv oder sogar kontraproduktiv sind. Sie diskutieren untereinander, wie ein wirksamerer Aktivismus aussehen könnte.
In dieser mehrteiligen Blogpost-Serie möchte ich einige dieser Diskussionen vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen äußerer Transformation und Inner Work beschreiben. Ich beschreibe zuerst einige Gründe hinter der selbst-reflexiven Wende. Dann skizziere ich eine dieser Kritiken im Detail; Anthea Lawson’s These des „Entangled Activism“, des „verstrickten Aktivismus“. Von dort mache ich einen Bogen zur zeitgenössischen Trauma-Forschung und meinen eigenen Erfahrungen in einem Training als Collective Trauma Facilitatorin um herauszuarbeiten, inwiefern Traumatisierungen die Bandbreite unserer Handlungen als Aktivistinnen prägen und limitieren. Nach diesen Analysen beschreibe ich die Grundlagen eines „bezogenen Aktivismus“, der sich liebevoll der eigenen Verstrickung in den Metakrisen, die er zu lösen versucht, bewusst ist. Ich skizziere die Arbeit einiger Trauma-sensitiven NGOs und lege dar, welche inneren Kompetenzen dabei helfen neue, effektive Haltungen und Strategien zu entwickeln.
Ich schreibe diese Überlegungen in dem Versuch auf, mich selbst zu verorten und andere, insbesondere Dich als Leserin, in den Erkenntnisprozess einzubeziehen. In den kommenden Monaten haben ich und meine Kolleginnen im betterplace lab und bei innerwork.online verschiedene Gelegenheiten – von Vorträgen über Workshops bis hin zu einer mehrmonatigen Forschungsgruppe – die Möglichkeit uns dem Themenkomplex „bezogener Aktivismus“ tiefer zu widmen und hoffen mehr beitragen zu können als es diese erste Skizze vermag.
Vorab: Obwohl in diesen Artikeln einige etablierte aktivistische Ansätze in Frage gestellt werden, bin ich zugleich zutiefst von der Notwendigkeit aktivistischer Arbeit überzeugt und schätze viele Organisationen und Akteurinnen als essentielle Bestandteile unserer von Wirtschaft und Politik dominierten Gesellschaft. Ebenso bin ich in den letzten Jahren zu der Überzeugung gelangt, dass die organisierte Zivilgesellschaft ein Update braucht, um wirklich adäquate, innovative Antworten auf die dringenden Fragen unserer Zeit zu finden und umzusetzen. Andernfalls trägt sie weiter zu Fragmentierung und Polarisierung, und damit unbewusst zu einer Vertiefung der Metakrisen, bei. Ich verstehe die hier skizzierten Ideen und Antworten als einen Teil eines solchen Updates.
Drei Gründe hinter der kritischen Selbsterforschung
Seit ihrem Entstehen in den 1970er Jahren gab es in der internationalen NGO- und Aktivismus-Szene immer wieder bedeutsame Wellen der Selbstkritik und Reflexion. Mich interessieren hier die Stimmen, die in den letzten Jahren die eigene Arbeit hinterfragen. Die Beweggründe für diese aktuelle Selbstanalyse sind vielschichtig, mir stechen jedoch drei Faktoren besonders ins Auge:
Zum einen sehen viele Aktivistinnen, dass ihre Arbeit nicht die erwünschte Wirkung erzeugt. Angesichts der sich zuspitzenden Metakrisen in zentralen Lebensbereichen wie Klima, Demokratie, psychologische Gesundheit und Überwachungskapitalismus gestehen Aktivistinnen sich ein, dass sie ihre Ziele verfehlen, ja, dass sich die Welt weiter denn je von ihren Vorstellungen entfernt. So sprechen Menschenrechtsaktivistinnen offen aus, dass mit der verschärften EU-Migrationspolitik ihre Arbeit der letzten Jahrzehnte gescheitert ist. Herausragende Umweltaktivistinnen, darunter der Sprecher von Extinction Rebellion UK, konstatieren öffentlich, dass ihre Aktionen mehr Menschen verschrecken, statt sie für die Umweltbewegung zu gewinnen. In die gleiche Kerbe schlägt einer der Gründer von Occupy, wenn er schreibt, dass die 99% heute weiter denn je davon entfernt sind, Machtverhältnisse nachhaltig zu verändern. Die Kluft zwischen aktivistischen Taktiken und der Macht des extrahierenden Kapitalismus und zerbrechenden demokratischen Strukturen erscheint unüberbrückbar und das eigene Scheitern fast unausweichlich.
Zweitens durchlaufen viele aktivistische, zivilgesellschaftliche Organisationen gerade selbst interne Krisen.Teams explodieren, da Mitarbeiterinnen unterschiedliche Haltungen zu zentralen Fragestellungen haben. Die hitzige Atmosphäre kann teilweise als ein Ventil für größere Frustrationen angesehen werden: wer sich in der gesellschaftspolitschen Arena der Trumpisierung machtlos ausgeliefert fühlt, wird im überschaubaren privaten und beruflichen Rahmen zum umso strengeren Sittenwächter. Zugleich aber brechen in diversen Teams erstmalig ernsthafte Fragen nach Privilegien und Diskriminierung innerhalb der eigenen Organisation auf. Gruppen, die angetreten sind, zentrale Pathologien in der Gesellschaft wie Rassismus oder Polarisierung zu bekämpfen, sind mit den gleichen Dynamiken innerhalb ihrer Teams konfrontiert. Doch da diese Themen komplex und tiefsitzend sind, fühlen sich die Beteiligten oft zurecht überfordert, diese wirksam konstruktiv durchzuarbeiten.
Und drittens gestehen sich immer mehr Aktivistinnen und Engagierte den hohen persönlichen Preis ein, den sie für ihre Arbeit zahlen. Sie fühlen sich überfordert, verzweifelt und ausgebrannt; ihre Lebensgrundlagen sind oft prekär und unsicher. Eine Zahl kann dies veranschaulichen: In einer Umfrage unter jungen Sozialunternehmerinnen und Aktivistinnen im Netzwerk von ChangemakerxChange gaben 59% aller Befragten an, Burnout-Erfahrungen zu haben und nur 9% konnten sich mit ihrer Arbeit vollständig finanzieren (2022).
Innenschau statt Projektion
In allen diesen Fällen ist es leicht, äußere Faktoren zu beschuldigen: regressive, populistische Politikerinnen, engstirnige Mitarbeiter, unzureichende Ressourcen für Gemeinwohl-orientierte Arbeit. Doch obwohl solche äußeren Faktoren zweifelsohne eine wichtige Rolle spielen, lagern die Aktivistinnen, die mich hier interessieren, diese Probleme nicht nur nach außen aus, sondern wenden sich auch nach Innen. Sie reflektieren, inwieweit sie selbst mit den Problemen verstrickt sind, die sie versuchen zu lösen. Sie hinterfragen, welchen Anteil ihre eigenen Haltungen und Bedürfnisse, Verhaltensweisen und Aktivitäten daran haben, dass sie die sozialen und ökologischen Probleme nicht überwinden, sondern diese eventuell sogar noch verstärken.
Verstrickter Aktivismus
2021 erschien The Entangled Activist der britischen Aktivistin und Campaignerin Anthea Lawson, ein Buch, das sich offen damit auseinandersetzt, wie Aktivismus in die gleichen Probleme verstrickt ist, die es auflösen will. Die Autorin blickt auf eine lange NGO-Karriere zurück, während derer sie u.a. half Steuerlöcher zu stopfen, Korruption aufzudecken und Streubomben zu verbieten. In The Entangled Activist beschreibt sie ihren eigenen Erkenntnisweg. Nachdem sie jahrelang geglaubt hatte, ihre Aufgabe sei es, ‘die Bastarde zu schnappen’, gewinnt sie die Einsicht, dass Aktivismus oft aus denselben Problemen entsteht, die er zu beheben versucht, und dass seine Dämonen, wie Selbstgerechtigkeit, Rettertum, Burnout und die schlechte Behandlung anderer Menschen, ein Tor zum Verständnis dessen sein können, was wirklich geändert werden muss.
Zu den Denkmustern und Handlungen, die zu den Metakrisen, u.a. im Bereich Klima, Demokratie oder Überwachungskapitalismus geführt haben, gehört unser hyperindividualistisches Menschenbild, das davon ausgeht, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist und die Welt nach seinen Bedürfnissen ordnen kann. Die gleiche Überzeugung vertreten auch viele Aktivistinnen, Sozialunternehmerinnen und andere Engagierte. Nur, dass sie jetzt die Welt nicht mehr ausbeuten, sondern heilen und wiederherstellen wollen.
Hanno Burmester beschreibt dieses Rettungsdenken so:
Seit der Neuzeit verstehen wir uns im Westen als Individuen, die durch ihr Handeln die Welt ordnen und gestalten. Wo wir bislang entschieden haben, dass wir erobern, plündern und ausbeuten, wollen wir jetzt wiedergutmachen, zurückgeben, heilen. Letzteres ist mir lieber als Ersteres. Aber es bleibt dabei, dass in unserem Selbstbild wir es sind, die ordnen. Dass wir die Natur als Objekt erkennen, nicht als Vielzahl von Co-Akteuren.
Diese über Jahrhunderte kultivierte Hybris lässt uns vergessen, dass nicht wir es sind, die Ordnung schaffen. Es sind auch nicht wir, die heilen. Die fragile Ordnung des Ökosystems erschafft sich im Zusammenspiel allen Lebens. Wir tragen im besten Fall einen kleinen Teil dazu bei, diese Bewegung auf heilsame Art zu unterstützen.
Die Trennung zwischen Mensch und Natur spiegelt sich in kleinerem Maßstab in der Trennung wieder, die viele Aktivisten zwischen sich und der Welt wahrnehmen. Lawson zufolge sehen sie eine verquere, falsche Welt „da draußen“ und ihre Aufgabe ist es, diese zu verändern. Im Bewusstsein, selbst mehr zu wissen als andere, altruistischer und wertvoller zu sein, als die dumpfe Mehrheitsbevölkerung oder die bösen Täter, ist es leicht sich überheblich und „besser“ zu fühlen und auf andere dementsprechend rechthaberisch zu wirken.
Aktivistenstrategien bauen Druck auf. Manche nutzen „blame and shame“ Taktiken, die im eklatanten Gegensatz zu ihren eigenen Prinzipien stehen, beispielsweise wenn Menschenrechtsaktivistinnen ihren Gegnern jede eigene Menschlichkeit absprechen. Besonders kritisch ist es, wenn die eigene Position nicht nur als “richtig”,sondern auch noch als moralisch höher stehend und der Gegner als “böse” betrachtet wird. Diese Muster werden nochmals dadurch verstärkt, dass wir uns in einer existentiellen Gefahrenlage befinden und der innere Druck und die Angst vieler Aktivistinnen enorm groß sind. So trägt die problembasierte Rhetorik vieler Aktivistinnen zu einem sich steigernden Klima der Angst und Unsicherheit bei.
Dass diese Druckwellen auf Widerstand stoßen, nicht nur in der Gruppe der direkten Antagonisten, sondern auch in der breiteren Bevölkerung, verwundert wenig. Denn Druck erzeugt Gegendruck. Die direkt oder indirekt angesprochenen Zielgruppen fühlen sich missverstanden, angeklagt und verfolgt. So können sich in der breiteren Öffentlichkeit immer weniger Menschen mit Aktivistinnen identifizieren. Viele Bürger lehnen Aktivismus als aggressiv und besserwisserisch ab, obwohl sie selbst über den Zustand der Welt besorgt sind und sich Alternativen wünschen.
Können wir anerkennen, Teil des Problems zu sein? Und damit in der besten Position, zur Lösung beizutragen?
Campaigner und Aktivistinnen, die sehr gut darin sind Feinde im außen zu identifizieren, neigen dazu interne Konflikte nach dem gleichen Muster zu führen. In den letzten Monaten habe ich mit mehreren Organisationen gesprochen, die sich für Diversität und solidarische Beziehungen einsetzen und zugleich innerhalb ihrer eigenen Teams mit hitzigen Diskussionen rund um Rassismus und strukturelle Diskriminierung konfrontiert sind. Eine ähnliche Situation ist aus US-amerikanischen NGOs bekannt, in denen Schwarze, ermächtigt durch die Black Lives Matter Bewegung, sich erstmalig zu ihren Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz äußerten und neue Fronten zwischen weißen und Schwarzen Mitarbeiterinnen, Menschen mit und ohne Behinderungen, bzw. anderen Subgruppen sichtbar wurden. Insgesamt sind in den letzten Jahren in zahlreichen NGOs weltweit eklatante Missbrauchspraktiken und Diskriminierungen bekannt geworden, genau die Form von toxischen Dominanzhierarchien, die die Organisationen in der Welt bekämpfen wollen. (Ich werde in einem späteren Blogpost ausführlicher auf die Rolle von Identitätspolitik im Aktivismus eingehen).
Nun ist es nicht verwunderlich, dass Organisationen, die versuchen systemische Missstände zu bearbeiten, genau mit diesen auch intern konfrontiert sind. Das fängt mit dem Gründungsimpuls vieler aktivistischer Organisationen an: Menschen wählen eine bestimmte Rolle und ein Betätigungsfeld, weil sie selbst eng mit diesen verbunden, bzw. verstrickt sind und etwas verändern und beitragen wollen. So ist die Organisation bereits durch ihre Gründerinnen und Mitarbeiterinnen geprägt. Auf der Basis dieser Ausgangslage versuchen Aktivistinnen dann miteinander zu arbeiten, aber da Rassismus und strukturelle Diskriminierung, Desinformation und Radikalisierung keine Oberflächenphänomene sind, die wir mit ein paar strukturellen Maßnahmen beseitigen können, schlagen sie unweigerlich auch in den Organisationen selbst auf. Um sie zu bearbeiten braucht es dann nicht nur eine intellektuelle Beschäftigung, sondern einen tiefen inneren Haltungswandel, der von den Beteiligten intrinsische Motivation und Verletzbarkeit erfordert und für den ausreichend Zeit und Geld zur Verfügung stehen muss. Doch diese für eine wirksame Selbsterforschung notwendigen Bedingungen fehlen in vielen Organisationen.
Das wiederum hat mit der Arbeitskultur an sich zu tun. Denn auch in diesem Bereich sind Aktivistinnen und Changemakern mit den Strukturen, die sie/wir selbst verändern wollen, unheilvoll verstrickt. Viele NGOs beklagen den kapitalistischen Wachstumswahn und den Ethos der Leistungsgesellschaft. Zugleich erzeugen wir selbst einen unheimlichen Leistungsdruck. Unsere Terminkalender sind berstend voll, wir sind extrem Output-orientiert und versuchen unsere Angebote weltweit zu skalieren. Wir konkurrieren mit anderen Organisationen um Fördertöpfe und grenzen uns dementsprechend von diesen ab. Dadurch werden nicht nur selbstkritische Reflexionen, sondern auch sinnvolle Kollaborationen zwischen Organisationen, die eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, verhindert.
Sozialisiert in eine Gesellschaft, die harte Ergebnisse, Zahlen und Fakten höher wertschätzt als die subjektiven und qualitativen Facetten des Lebens, verwundert es nicht, dass auch die Aktivstenwelt aus der Balance ist. In vielen Aspekten, außer der Bezahlung, unterscheidet sich die Arbeit in einer transnationalen NGO nur wenig von der eines transnationalen Konzerns. In einem Report des Carnegie Trusts über das Klima in zivilgesellschaftlichen Organisationen heißt es: „kindness, emotions and human relationships are blind spots“.“ Kein Wunder, dass die Lebensqualität vieler Aktivistinnen schlecht ist, Burnout, Ängste, Aggressionen und Depressionen die Mitarbeiterinnen belasten.
Doch immer mehr zivilgesellschaftlich Engagierte werden sich bewusst, dass sie sich in ihren Organisationen nur mit bestimmten, “professionellen” Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen und ihre zarten, weichen und tieferen Teile dabei verkümmern. Zugleich sehen sie, dass dieses Versteckspiel und managen der eigenen Bedürfnisse und Interessen sich direkt auf ihre Arbeit, ihre Strategien, ihre Rhetorik und ihre Verhaltensweisen auswirken. Konkret: Menschen, die von zentralen Aspekten ihres eigenen Lebens entfremdet sind, können im Außen keine ganzheitlichen Veränderungsprozesse anschieben.
::
Weiter zum 2. Teil: Trauma, Fragmentierung und Beziehungsfähigkeit